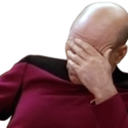K ein Gepäck ist so schwer in Bewegung zu versetzen wie Men- schen, schrieb der schottische National- ökonom Adam Smith 1776 in seinem Werk über den Wohlstand der Nationen. Die Menschen neigten dazu, in ihrer Heimat zu bleiben. Sie verlassen sie nur, wenn die Lebensumstände im Ausland deutlich besser sind als daheim, so Smith.
Weil es zu Smiths Zeiten noch keinen Wohlfahrtsstaat gab, galten dem Schotten höhere Löhne im Ausland als wichtigster Pull-Faktor für Migranten. Heute ist die Welt komplizierter. In den reichen Indus- trieländern locken nicht nur hohe Löhne, die Menschen haben dort auch Ansprüche auf Sozialleistungen. Weil diese häufig hö- her sind als die Pro-Kopf-Einkommen der Menschen in Entwicklungsländern, kön- nen auch sie ein Lockmittel sein- und Wanderungsbewegungen in Gang setzen.
So wie derzeit nach Europa, insbeson- dere nach Deutschland. Von 2012 bis Ende 2022 wanderten 6,1 Millionen Menschen nach Deutschland, viele von ihnen als Asylbewerber. Die unkontrollierte Mas- seneinwanderung ist zum gesellschaftli- chen Großproblem geworden. Flücht- lingsunterkünfte platzen aus allen Nähten, die staatlichen Ausgaben für die Einwan- derer schießen in die Höhe, die sozialen Spannungen nehmen zu.
UMSTRITTENE THESE
Anfang der Woche beschlossen Bund und Länder deshalb, den Zugang von Asylbe- werbern zu Sozialleistungen sowie Bar- zahlungen an diese einzuschränken. Das soll die Sogwirkung des deutschen Sozial- staats senken. Kann das funktionieren?
Fakt ist, dass nur wenige Länder auf der Welt so großzügig Geld an Einwande- rer verteilen wie Deutschland. Ein allein- stehender Asylbewerber hat hierzulande Anspruch auf eine monatliche Unterstüt- zung von 410 Euro. Wird seinem Asylan- trag stattgegeben, erhält er Bürgergeld, das sich aktuell auf 502 Euro beläuft - et- wa fünf Mal so viel wie das durchschnittli- che monatliche Pro-Kopf-Einkommen in ärmeren Entwicklungsländern.
Das legt nahe, dass der deutsche Wohl- fahrtsstaat wie ein Magnet auf die Mittel- losen dieser Welt wirkt. Doch unter Öko- nomen ist diese These umstritten. Zu
behaupten, die Flüchtlinge kämen wegen des großzügigen Sozialstaats nach Deutsch- land, sei wissenschaftlich absurd, sagt der Migrationsforscher Gerald Knaus. Herbert Brücker, Leiter des Forschungsbereichs Mi- gration am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, glaubt, dass die Aussicht auf Sozial- leistungen eher eine untergeordnete Rolle für die Migranten spielt. In vielen wissen- schaftlichen Studien sei kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Höhe der Sozialleistungen und der Wahl des Ziellan- des festzustellen, sagt Brücker.
Doch es gibt auch andere Stimmen. Die an der US-Eliteuni Princeton for- schenden Ökonomen Ole Agersnap, Ama- lie Sofie Jensen und Henrik Kleven haben untersucht, wie sich Änderungen der So- zialleistungen für Immigranten in Däne- mark auf die Einwanderung auswirkten. Die Regierungen in Kopenhagen hatten die Transferleistungen für Migranten aus Nicht-EU-Ländern in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach geändert.
Dabei zeigte sich, dass Asylbewerber und Familiennachzügler stark auf die Än- derungen reagierten. Nach der ersten Kür- zung sank die Anzahl der Zuwanderer vier Jahre in Folge. Als die Leistungen wieder angehoben wurden, legte auch die Zuwan-
derung wieder zu. Für Familien wurden die Leistungen
in Dänemark um bis zu umgerechnet 800 Dollar gekürzt. Das habe die Nettozuwan- derung um 3,5 Prozent der in Dänemark ansässigen Immigranten reduziert und stütze die Hypothese, dass von staatlichen Sozialleistungen „große und stark signifi- kante Magneteffekte" auf Asylbewerber ausgehen, schreiben die Forscher.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt ei- ne Studie der Ökonomen Peter Huber und Fanny Dellinger vom österreichischen In- stitut für Wirtschaftsforschung (WIFO) und der Uni Innsbruck. Sie untersuchten den Einfluss von Sozialleistungen auf die Wohnortwahl von Flüchtlingen in Öster- reich. Wird diesen Asyl oder subsidiärer Schutz gewährt, können sie ihren Wohn- ort frei wählen. In Österreich variieren die Sozialleistungen je nach Bundesland und Schutzstatus der Migranten. Asylberech- tigte können ihren Leistungsanspruch da- her durch Wohnortwechsel zum Teil er- heblich steigern.
Es zeigte sich, dass die Migranten in jene Bundesländer strömen, die ihnen die höchsten Transferzahlungen versprechen.
Unterschiede in der Höhe der Sozialleis- tungen zwischen den Bundesländern stei- gerten die Mobilität der Flüchtlinge im Schnitt um elf Prozentpunkte auf 60 Pro- zent, schreiben Huber und Dellinger. Das spreche für die Hypothese der Magnetwir- kung wohlfahrtstaatlicher Leistungen.
Heißt das nun, dass Kürzungen der Sozialleistungen für Flüchtlinge die Mas- senzuwanderung stoppen können? So ein- fach ist das nicht. Agersnap und Co. weisen in ihrer Studie darauf hin, dass die Ent- scheidung, die Heimat zu verlassen, durch viele Faktoren bestimmt wird, die nichts mit der Aussicht auf Sozialleistungen im Zielland zu tun haben. Habe sich ein Mi- grant allerdings entschieden, sein Heimat- land zu verlassen, sei bei der Wahl des Ziel- landes die Großzügigkeit des dortigen Sozialsystems durchaus von Bedeutung.
Auch IAB-Forscher Brücker schließt nicht gänzlich aus, dass die Höhe der Sozi- altransfers einen Einfluss auf die Wahl des Ziellandes hat. Doch seien andere Fakto- ren wichtiger. „Entscheidend ist, wie leicht Flüchtlinge Zugang in ein Land er- halten, wie hoch die Bleibewahrschein- lichkeit dort durch Anerkennung ihres Asylgesuchs ist und welche Beschäfti- gungsperspektiven sich dort bieten", sagt er. Einseitige Leistungskürzungen sieht er kritisch. Sie drohten die Wanderungsströ- me in andere Länder der EU umzulenken, ohne dass der Migrationsdruck sinkt. Zu- dem können sie, wie das dänische Beispiel zeige, die Integration beeinträchtigen.
Offenbar bedarf es heute, da die Men- schen mobiler sind als zu Lebzeiten von Adam Smith, mehr als nur einer Kürzung von Sozialleistungen, um des Migrations- drucks Herr zu werden.